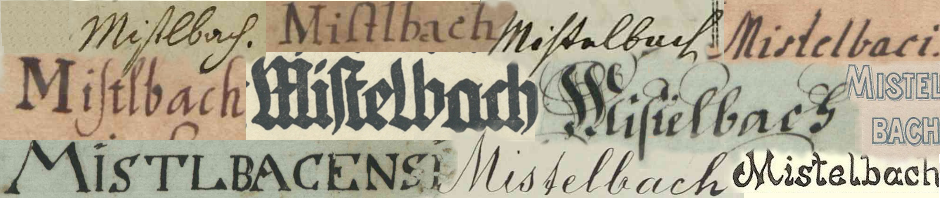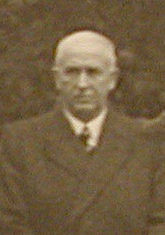k.k. Güterschätzmeister fürstl. Hofrat Anton Hackler
* 20.4.1790, Herrnbaumgarten
† 15.4.1871, Wien
Anton Hackler wurde 1790 als Sohn des bürgerlichen Handelsmanns für Kurrentwaren (=Textilien) und Wirtschaftsbesitzers Philipp Hackler und dessen Gattin Anna Maria, geb. Hager, in Herrnbaumgarten geboren.1 Aufgrund seiner späteren Berufslaufbahn ist anzunehmen, dass ihm während seiner Jugend eine höhere Schulbildung zuteilwurde. Am 11. Mai 1818 ehelichte er Franziska Seiberler (*1796, †1847) , die Tochter des Paasdorfer Herrschaftsverwalters Franz Seiberler in der Paasdorfer Pfarrkirche.2 Dieser Ehe entstammten mindestens drei Kinder. Für das Jahr 1818 sind auch erste berufliche Spuren auffindbar und zwar scheint Hackler als Verwalter der Herrschaft Walterskirchen auf, zu der auch Böhmischkrut (=Großkrut) und Althöflein gehörten und die sich damals im Besitz des Fürsten von Kohary befand.3 Dieses Amt hatte er mindestens bis zum Jahr 1823 inne.4 Auch einer seiner Brüder, Philipp Anton Hackler, war als Verwalter bzw. Amtmann bei verschiedenen Herrschaften tätig, unter anderem in Matzen und Prinzendorf, und stieg später auch zum Direktor bedeutender Güterverwaltungen auf.5
1825 wird Hackler laut einem Dominien-Schematismus als Amtmann der dem Johanniter-Orden gehörenden Herrschaft in Mailberg angeführt.6 Wie lange er in Mailberg beschäftigt war ist unklar, und da zwischenzeitlich keine Verzeichnisse der in Niederösterreich tätigen Herrschafts-Beamten erschienen, finden wir ihn erst 1834 bis 1844 als „Wirtschaftsrath“ der Herrschaft Dürnstein und damit im Dienste des Fürsten von Starhemberg wieder.7 Parallel dazu scheint er jedenfalls ab 1842 auch als „Wirtschaftsrath“ der Herrschaft Paasdorf, die auch große Besitzungen in Schrick und Hüttendorf umfasste und sich im Besitz der Gräfin Harsch bzw. später des Freiherrn von Skrbensky befand, auf.8 Als Wirtschaftsrath bezeichnete man damals einen fachkundigen Beamten der seitens der Besitzer mit deren Vertretung betreffend die Führung und Aufsicht über eine (oder mehrere) Grundherrschaften betraut wurde. Die Kontrolle der anderen Herrschaftsbeamten, der wirtschaftlichen Aufzeichnungen und Verträge, sowie Anordnungen zur effizienten wirtschaftlichen Führung gehörten zu seinen Aufgaben während regelmäßiger Visitationen über die er anschließend den Besitzern Bericht zu erstatten hatte. Diese beide Ämter konnte er augenscheinlich auch von seinem Wohnsitz in Wien, wo er an verschiedenen Adressen in der Wiener Innenstadt, dem Vorort Wieden und zuletzt in Mariahilf wohnte, ausüben. Ab 1828 war Hackler zusätzlich auch als Gülten- und Güterschätzmeister beim „k.k. nö. Landrecht“ – einem Sondergerichtsstand des Adels – tätig und seine Aufgabe dort entsprach der eines gerichtlich beeideten Sachverständigen für die Bewertung landwirtschaftlicher Güter und die daraus erwirtschaftbaren (herrschaftlichen) Einkünfte (=Gülten).9 In dieser Funktion stand er in späteren Jahrzehnten auch dem Landesgericht Wien zur Verfügung.10 Als anerkannter Fachmann war Hackler Mitglied im Ausschuss der k.k. Landwirtschafts-Gesellschaft in Wien11, und gehörte über viele Jahre auch dem Ausschuss des „Pensions-Instituts für Witwen und Waisen herrschaftlicher Wirtschaftsbeamter in Niederösterreich“ an.12
Mit dem Ende der Grundherrschaft als Folge der Revolution von 1848 wandelte sich das Aufgabenfeld der vormals herrschaftlichen Beamten bzw. reduzierte sich deren Zahl, da die den Grundherrschaften seit Jahrhunderten übertragenen hoheitlichen Aufgaben in Verwaltung (bspw. Steuereinnahme für den Staat) und Rechtsprechung entfielen und nun von neugeschaffenen Behörden und Gerichten übernommen wurden. Ebenso entfiel die aufwändige Verwaltung der von den Untertanen zu leistenden Abgaben (Zehent) und Dienste (Robot). Abgesehen von der sich über Jahre hinziehenden finanziellen Ablösung der grundherrschaftlichen Rechte und Ansprüche hatten die Beamten der adeligen Familien und sonstigen Grundbesitzer nunmehr lediglich die Verwaltung der eigenen landwirtschaftlichen Güter zu besorgen. Es ist daher anzunehmen, dass mit dieser Zäsur im ländlichen Raum auch Hacklers Tätigkeit für die Herrschaft Paasdorf endete. Ab 1851 scheint Hackler dann als Direktor der gräflich sándor’schen Central-Güterverwaltung in Wien auf.13 Die ungarische Magnatenfamilie Sándor (von Slavnica) zählte zu den reichsten Familien Ungarns und besaß umfangreiche Güter, zu denen nicht nur landwirtschaftliche Betriebe und Pferdegestüte, sondern etwa auch Bergwerke gehörten. Graf Moritz Sándor, der letzte männliche Spross dieser Familie, residierte in Wien und war ein abenteuerlustiger Draufgänger der für seine waghalsigen Reitkünste weithin bekannt war. Sein Übermut musste früher oder später ins Unglück führen und so zog er sich bei einem Reitunfall schwere Kopfverletzungen zu, die sich auch massiv auf sein Gehirn bzw. seine geistige Verfassung auswirkten. Daher wurde er mit Beschluss des Landesgerichts Wien vom 19. August 1851 wegen „gerichtlich erhobenen Wahnsinns“ unter Kuratel gestellt und der Direktor seiner Güterverwaltung Anton Hackler zu seinem Kurator bestellt.14 Obwohl sich der Geisteszustand des Grafen nicht wesentlich gebessert hatte wurde die Kuratel 1858 aufgehoben, allerdings wurde sie einige Jahre danach erneut verhängt, doch zu einem Zeitpunkt zu dem sich Hackler bereits in den Ruhestand zurückgezogen haben dürfte. Graf Sándor war ein Schwiegersohn des ehemaligen Staatskanzlers Metternich und sein einziges Kind, Tochter Pauline, war dessen Lieblingsenkelin. Pauline war auch mit einem Mitglied der Familie Metternich – Richard, dem Halbbruder ihrer Mutter – verheiratet, der Österreich als Gesandter am sächsischen Königshof in Dresden vertrat. Das in wirtschaftlichen Angelegenheit unbedarfte junge Paar pflegte dort ein luxuriöses Leben und hielt ausschweifende Empfänge und Feste ab und hatte sich binnen kurzer Zeit hochverschuldet. Es spricht für das hohe Ansehen und die großer Fachkompetenz Hackler, dass dieser auf Anregung Metternichs als Wirtschaftsfachmann nach Dresden geschickt wurde um dessen Enkelin (und Schwiegertochter in Personalunion) und ihrem Gatten die Grundlagen vernünftiger finanzieller Gebarung und effizienter Verwaltung ihrer Güter beizubringen. Metternich dürfte Hacklers Kompetenz wohl als Kurator des Grafen Sándor kennen und schätzen gelernt haben, schließlich hatte er nach dem Unfall des Grafen die Vormundschaft seiner Enkeltochter Pauline übernommen und unzweifelhaft hatten die beiden Herren Kontakt bezüglich deren Unterhalt. Hacklers Mission in Dresden war erfolgreich: unter seiner Anleitung gelang es die Finanzen nachhaltig in Ordnung zu bringen und nach zwei Jahren waren der österreichische Gesandte und seine Gattin schuldenfrei.15 Da Hackler später in sämtlichen Meldungen zu seinem Ableben als „pensionierter fürstlich metternichscher Hofrath“ ist zu vermuten, dass er diesen Titel zum Dank für die damals geleisteten Dienste erhalten hatte.16 Nach diesem Intermezzo in Dresden wirkte Hackler jedenfalls bis zum Jahr 1860 weiterhin als Direktor der Zentral-Güterverwaltung des Grafen Sándor17 und naturgemäß führten ihn geschäftliche Reisen auch immer wieder nach Ungarn bzw. in dessen Hauptstadt Budapest.18
Als 1860 der Paasdorfer Friedhof außerhalb des Dorfes neu angelegt wurde stiftete Hackler zunächst ein Kreuz mit einem aus Eisen gegossenen und vergoldeten Korpus Christi, das in der Mitte des neuen Friedhofs aufgestellt wurde.19 Das heute auf dem Friedhof vorhandene Kreuz entspricht natürlich nicht mehr dem Original, aber mit großer Wahrscheinlichkeit dürfte dies auf die zwischenzeitlich sicherlich mehrfach renovierte Christus-Figur zutreffen. Durch die Neuanlage des Friedhofs sah Hackler die Gelegenheit gekommen um mit der Errichtung einer Friedhofskapelle samt darunterliegender Familiengruft dem Ort ein bleibendes Denkmal zu stiften und für sich und seine Familie eine standesgemäße letzte Ruhestätte zu schaffen. Schließlich hatte Hackler wie er in dem 1861 aufgesetzten Stiftbrief der Friedhofskapelle festhielt zu Paasdorf eine besondere Zuneigung20, die sich wohl wie folgt begründen lässt: In der Paasdorfer Pfarrkirche hatte er den Bund der Ehe geschlossen, mit einer Frau, die als Tochter des Herrschaftsverwalters, wohl auch einige ihrer Jugendjahre in Paasdorf zugebracht haben dürfte und wie oben erwähnt war er über viele Jahre mit der Aufsicht über die Herrschaft Paasdorf betraut. Daneben gab es auch noch weitere familiäre Verbindungen zu Paasdorf: Hacklers älterer Bruder Johann hatte bereits 1805 nach Paasdorf eingeheiratet und lebte dort als Landwirt.21 Dessen Sohn Johann Hackler jun., also Anton Hacklers Neffe, war von 1840 bis 1870 Oberlehrer in Paasdorf und hatte auch die mit Lehrerstelle oftmals verbundenen Ämter des Regenschori und Mesners inne.22
 Vorderansicht der 1861 von Anton Hackler gestiftete Friedhofskapelle
Vorderansicht der 1861 von Anton Hackler gestiftete Friedhofskapelle
 Seitenansicht der Kapelle unter der sich die Gruft der Familie Hackler befindet
Seitenansicht der Kapelle unter der sich die Gruft der Familie Hackler befindet
Um die Fläche des neuen Friedhofs nicht zu schmälern kaufte Hackler ein anliegendes Stück Acker an und verleibte dieses dem Friedhof ein. Nachdem er ein entsprechendes Stiftungskapital zur Erhaltung der Kapelle hinterlegt hatte wurde der Bau seitens der Behörden und der Erzdiözese genehmigt und am 12. Oktober 1861 wurde die Kapelle eingeweiht. Die vom Gaweinstaler Baumeister Lehrl erbaute Kapelle wird im Inneren von einem großen den auferstandenen Heiland zeigenden Altarbild, das vom Wiener Künstler Carl Geiger geschaffen wurde, geziert. Im Türmchen hängt eine 153 kg schwere dem heiligen Anton von Padua (dem Namenspatron des Stifters) geweihte Glocke.23 Laut Stiftungsbrief sollten jährlich am Sterbetag Hacklers und an Allerseelen eine Messe in der Kapelle gelesen werden, letztere fand gesichert jedenfalls noch bis vor wenigen Jahren statt.
Hackler war im Lauf seines Lebens mit einigen persönlichen Schicksalsschlägen konfrontiert: drei seiner Kinder starben in der Blüte ihrer Jugend24 und auch seine Gattin ging ihm bereits im Jahre 1847 im Alter von 51 Jahren in die Ewigkeit voraus.25 Im Dezember 1868 ließ er die exhumierten sterblichen Überreste seiner Gattin, zweier Kinder und seines Schwagers von Wien nach Paasdorf überführen und hier in der Gruft bestatten.26 Anton Hackler verstarb am 15. April 1871 in seiner Wohnung am Wiener Getreidemarkt an Altersschwäche und wurde drei Tage später in der Gruft der von ihm erbauten Friedhofskapelle beigesetzt.27
Nachdem etwa um 1990 die letzten Nachfahren Hacklers in Wien verstorben waren, fiel die Friedhofskapelle in den Besitz der Gemeinde und selbige wurde in den Folgejahren gründlich renoviert.28 Im Zuge der Einführung von Straßenbezeichnungen in der Katastralgemeinde Paasdorf wurde mit Beschluss des Mistelbacher Gemeinderates vom 10. Dezember 1998 beschlossen in Erinnerung an den Stifter der Kapelle, die zum Friedhof (bzw. daran vorbei-) führende Straße „Anton Hackler-Gasse“ zu benennen.
Wo befindet sich die Anton Hackler-Gasse?
Quellen: