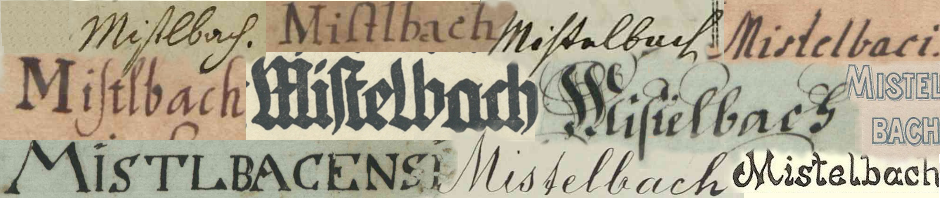Nachfolgend ein Beitrag über die wechselvolle Geschichte des Hauses Bahnstraße Nr. 5:
Café Schindler (1900-1906)
Das Areal der heutigen Häuser Bahnstraße Nr. 5 und 7 bzw. der unmittelbar dahinterliegenden Grundstücke in der Gspanngasse gehörte ursprünglich zum weitläufigen Komplex des alten Mistelbacher Spitals. Wohl um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die einst zum Spital gehörigen Gründe veräußert und im eingangs erwähnten Bereich fand sich Ende des 19. Jahrhunderts ein Holzlagerplatz, zuletzt im Besitz des jüdischen Holzhändler Abeles. Dieser nutzte mittlerweile andere Betriebsgründe in Mistelbach und hatte daher das Gelände 1896 veräußert. Zwei Jahre später erwarb Baumeister Josef Dunkl jun. einen Teil dieser Gründe und errichtete 1899 darauf das Haus Bahnstraße (um die Jahrhundertwende auch „Eisenbahnstraße“ genannt) Nr. 5. Das Haus wurde als Kaffeehaus entworfen und gebaut und am 1. Jänner 1900 eröffnete Franz Schindler darin sein Kaffeehaus.1 Schindler war lediglich eingemietet und das Gebäude stand weiterhin im Besitz des späteren Bürgermeisters Dunkl.
 Eröffnungsanzeige aus der Zeitung „Bote aus Mistelbach„
Eröffnungsanzeige aus der Zeitung „Bote aus Mistelbach„
Die Erwähnung in obiger Eröffnungsanzeige, dass es sich um das „erste Kaffeehaus in Mistelbach“ handle ist allerdings nicht korrekt. Zwar gab es zum damaligen Zeitpunkt kein anderes Kaffeehaus in der Stadt, aber schon zuvor, nämlich von etwa Mitte der 1850er bis jedenfalls Anfang der 1880er Jahre existierte in der Oberhoferstraße Nr. 16 (=KNr. 1) ein Kaffeehaus, das von der Familie Jechtl begründet wurde2, das von der Familie Jechtl begründet und von dieser bis in die 1870er Jahre geführt wurde.3 Mitte der 1880er dürfte sich das Kaffeehaus dann zu einem Gasthaus gewandelt haben, das bis in die 1970er Jahre bestand, zuletzt als Gasthaus Habich (nach den Vorbesitzern aber auch lange noch als „Antrey-Wirtshaus“ bekannt).4
Das Café Schindler orientierte sich am Stil der Wiener Kaffeehäuser, die damals ihre Hochblüte hatten, und ob des begrenzten Raumes im Erdgeschoss – eine bauliche Erweiterung erfolgte erst in den 1930er Jahren – sollen anfangs auch im 1. Stockwerk Lokalitäten für Vereine zur Verfügung gestanden haben.5 Im Juli 1903 legte Schindler die Gewerbekonzession für den Betrieb des Kaffeehauses zurück und selbiges wurde fortan von seiner Gattin Rosa Schindler geführt.6 Franz Schindler tritt danach nicht mehr in Erscheinung.
Café Rössler (1906-1911)
Im Februar 1906 kam es zu einem Betreiberwechsel: Heinrich Rössler (*1878, †1933) übernahm das Kaffeehaus von Frau Schindler und Rössler dehnte die täglichen Öffnungszeiten auf den Zeitraum zwischen halb 6 Uhr früh bis 2 Uhr nachts aus.7
 Das Café Rössler zwischen 1906 und 1911
Das Café Rössler zwischen 1906 und 1911
Zu einem richtigen Kaffeehaus gehörte damals das Billardspiel (Karambol), das schon im 19. Jahrhundert auch im Kaffeehaus Jechtl angeboten wurde und selbiges dürfte auch hier von Beginn an zur Ausstattung gehört haben. Der neue Eigentümer Rössler, laut Einschätzung des Berichterstatters im „Mistelbacher Bote“ vermutlich der beste Billardspieler des Bezirks8, konnte im April 1911 den berühmten Wiener Billardkünstler Georg Pfeiler in seinem Lokal begrüßen.9 Der professionelle Billardspieler Pfeiler zählte um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhunderts zu den besten Spielern Österreichs und war auch international für sein Kunstspiel bekannt.10 Im Café Rössler zeigte er sein Können und die besten Billardspieler Mistelbachs waren eingeladen sich bei Gewährung eines gewaltigen Punkte-Vorsprungs mit dem Meister zu messen. Wenig überraschend fanden sich in den nächsten Ausgaben des „Mistelbacher Bote“ keine Berichte über Sensationssiege von Herausforderern.
 Der Bereich rechterhand des Eingangs zur Zeit des Café Rössler. Bis Ende der 1950er Jahre befand sich der Billardtisch in diesem Bereich des Kaffeehauses. Bei dem stoßausführenden Herrn dürfte es sich um den Cafetier Rössler selbst handeln.
Der Bereich rechterhand des Eingangs zur Zeit des Café Rössler. Bis Ende der 1950er Jahre befand sich der Billardtisch in diesem Bereich des Kaffeehauses. Bei dem stoßausführenden Herrn dürfte es sich um den Cafetier Rössler selbst handeln.
 Eine weitere Innenansicht des Café Rössler – unmittelbar nach dem Eingang gerade ins Lokal fotografiert – die Kante des Billardtisches ist am rechten Bildrand erkennbar, ebenso wie die Queues hinter dem Ober; bei dem großgewachsenen Herrn hinter der Theke handelt es sich um den Cafetier Heinrich Rössler.
Eine weitere Innenansicht des Café Rössler – unmittelbar nach dem Eingang gerade ins Lokal fotografiert – die Kante des Billardtisches ist am rechten Bildrand erkennbar, ebenso wie die Queues hinter dem Ober; bei dem großgewachsenen Herrn hinter der Theke handelt es sich um den Cafetier Heinrich Rössler.
Auch Heinrich Rössler veräußerte den Kaffeehaus im Juni 1911 an Alois Kiesling, und eröffnete im Oktober desselben Jahres in der Mitschastraße das erste Kino der Stadt Mistelbach.
Café Kiesling (1911-1919)
Im Juni 1911 erwarben Alois (*1883, †1972) und Anna Kiesling das vormalige Cafe Rössler11 Sie übernahmen jedoch nicht nur den Kaffeehausbetrieb, sondern kauften das Gebäude von Dunkl und waren damit die ersten Betreiber, die auch Eigentümer des Hauses waren.12 Kiesling stammte aus Wolkersdorf, wo sein Vater von 1874 bis 1912 das Gasthaus beim Bahnhof (zuletzt Gasthaus Reich) betrieb. Nachdem Kiesling das Kaffeehaus 1919 an Heinrich Rabenseifner veräußert hatte, scheint ein Mann namens Alois Kiesling ab 26. August 1925 als Pächter des Hotel Rieder in der Bahnstraße auf und führte dieses bis 1931. Mit ziemlicher Sicherheit dürfte es sich dabei um den vormaligen Cafetier Kiesling gehandelt haben. Womit er sich zwischen dem Verkauf des Kaffeehauses und der Übernahme des Hotel Rieder verdingt hat ist unklar, allerdings ist durch sein reges Engagement im Mistelbacher Vereinsleben (Kriegsheimkehrerverband, Schützenverein, Musikverein) belegt, dass er auch in der dazwischen liegenden Zeit in Mistelbach ansässig war.
Café Rabenseifner (1919-1956)
Heinrich (*1884, †1967) und Hermine Rabenseifner folgten der Familie Kiesling mit 1. Juli 1919 als Eigentümer und Betreiber nach13. Zuvor hatte Rabenseifner das vis-á-vis gelegene traditionsreiche Gasthaus „Zum weißen Rössl“ geführt, dass sich zuvor seit 1799 im Familienbesitz befunden hatte. Unter Rabenseifner wurden größere Fenster eingebaut und 1932 erfolgte der Anbau des Spielzimmers (hinterer Trakt des Lokals)14, und dieser Zubau ist auch heute noch gut erkennbar, da er nur aus einem Erdgeschoss besteht. Die umfassende Neugestaltung des Jahres 193515, wurde ein Jahrzehnt später während der Kämpfe um Mistelbach Mitte April 1945 zunichte gemacht und das Kaffeehaus laut einem Zeitungsbericht „arg zugerichtet“. Doch binnen weniger Monate konnte das Lokal wiederhergestellt und der Betrieb erneut aufgenommen werden.16 Die Ära Rabenseifner endete am 31. Oktober 1956.
Café Beck (1956-1958)
Ab 1. November 1956 scheint als Betreiberin eine Frau namens Ditta Beck auf17, zweifellos eine Verwandte der nunmehrigen Eigentümerin des Hauses Maria Beck (*1906, †2002), auf deren Namen auch die Konzession zum Betrieb des Kaffeehauses lautete.18 Das Lokal wurde nunmehr unter dem Namen Café Beck geführt, ehe es ab Frühjahr 1958 verpachtet wurde.
 Ankündigung der Silvesterfeier im Café Beck zur Jahreswende 1956/57
Ankündigung der Silvesterfeier im Café Beck zur Jahreswende 1956/57
(Mistelbacher-Laaer Zeitung, Nr. 50/1956, Anzeigenteil)
Café M. Heindl (1958-1968)
Michael und Inge Heindl pachteten das Kaffeehaus im April 1958 und eröffneten es nach einmonatiger Schließung, während der eine umfassende, moderne Neugestaltung des Lokals erfolgte.19 Wohl um Verwechslungen mit dem Stadtcafe von Lorenz Heindl in der Franz Josef-Straße zu vermeiden, war das Lokal weiterhin unter dem etablierten Namen Café Rabenseifner bekannt20 bzw. teils wurde es zur Abgrenzung auch „Heindl-Rabenseifner“ genannt.
 Innenansicht des 1958 neueröffneten Café M. Heindl vom hinteren Bereich des Lokal Richtung Eingang
Innenansicht des 1958 neueröffneten Café M. Heindl vom hinteren Bereich des Lokal Richtung Eingang

Blick in den hinteren Bereich des Lokal: Spielzimmer mit Billardtischen und Fernseher an der Rückwand
Mit der Schließung des Café Heindl im März 1968 endete die 68 Jahre währende Nutzung des Gebäudes als Kaffeehaus – vorerst. Laut einem Bericht der Weinviertler Nachrichten wäre Heindl an der Weiterführung des Lokals und damit an einer Fortsetzung des Pachtverhältnisses interessiert gewesen, allerdings konnte er sich dem Vernehmen nach in finanziellen Belangen nicht mit der Eigentümerin einigen.21
Konsum (1968-1978)
1968 mietete sich die Konsumgenossenschaft Wien und Umgebung (KGW) – kurz „Konsum“ – ein und verlegte hierher das zuvor in der Franz Josef-Straße Nr. 54 beheimatete Verkaufsgeschäft, das an der neuen Adresse als Selbstbedienungsladen geführt wurde.22 1978 wurden die regionalen Konsumgenossenschaften unter dem Namen „Konsum Österreich“ fusioniert und der neue Dachverband erwarb das erst zwei Jahre zuvor neueröffnete „Plus-Kauf“ Warenhaus23 in der Mitschastraße (heute: BILLAplus). Statt der Filiale in der Bahnstraße wurde nunmehr ein Konsum-Großmarkt (KGM) in der vormaligen „Plus-Kauf“ Filiale eingerichtet.
Das Kaffeehaus als Konsum Filiale (1970er Jahre)
TILA (ca. 1979-1982)
Danach, also etwa von 1979 bis 1982, befand sich an der Adresse Bahnstraße Nr. 5 ein Verkaufsgeschäft der Bekleidungsfabrik TILA, die in Mistelbach eine Produktionsstätte in der ehemaligen Pinselfabrik in der Bahnzeile unterhielt.
 Das Erscheinungsbild nach der Schließung des Bekleidungsgeschäfts TILA, kurz bevor es sich zum Café Harlekin wandelte
Das Erscheinungsbild nach der Schließung des Bekleidungsgeschäfts TILA, kurz bevor es sich zum Café Harlekin wandelte
Café Harlekin (seit 1983)
Am 1. Juli 1983 eröffneten Reinhard und Walter Kruspel hier schließlich das bis heute bestehende Café Harlekin und knüpften damit wieder an die Kaffeehaustradition dieses Hauses an. Später trennten sich die Wege der Gründer und durch die Umgestaltung der Thomas Freund-Gasse zur Fußgängerzone im Jahre 1990 wurde der Schanigarten in der heute bekannten Form möglich.
 Das Innere des Café Harlekin kurz nach der Eröffnung im Sommer 1983
Das Innere des Café Harlekin kurz nach der Eröffnung im Sommer 1983
Exkurs: Die Anfänge der Eis-Tradition
Die älteste Spur der Speiseeisherstellung in Mistelbach findet sich in einem Inserat aus dem Jahr 1882 in der Lokalzeitung „Illustrirter Bezirks-Bote„, in dem Ferdinand Scholz, der von 1874 bis 1884 auf Hauptplatz Nr. 11 (danach bis 1938 Fam. Löffler, heute: Volksbank) eine Delikatessen-Handlung betrieb24, „täglich frisches Gefrornes“ (sic!) anbot.25 Gefrorenes ist ein heute veralteter Ausdruck für Speiseeis. Im Kaffeehaus selbst ist die Herstellung von Speiseeis durch Heinrich Rabenseifner jedenfalls bereits in der Zwischenkriegszeit belegt.
Ein Ausschnitt einer humoristischen Mehrbild-Postkarte legt jedoch den Schluss nahe, dass die Tradition der Speiseeisherstellung wahrscheinlich schon auf Kiesling zurückgehen dürfte, möglicherweise sogar bereits auf Rössler. Untenstehende Postkarte entstand vermutlich Anfang der 1910er Jahre, denn derartige Jux-Postkarten waren in der Zeit vor dem 1. Weltkrieg sehr populär. Aufgrund der Abbildung des Landesbahnhofs bzw. der ebenfalls erkennbaren Schießstätte im Bereich des heutigen Schützenwegs kann diese Karte jedenfalls erst nach 1906 entstanden sein.
 Eine Jux-Postkarte, geschrieben aus der Perspektive eines jungen Mädchens, vermutlich aus der Zeit Anfang der 1910er Jahre; darunter der relevante Bildausschnitt, der einen Hinweis auf den Beginn der Speiseeisherstellung liefert
Eine Jux-Postkarte, geschrieben aus der Perspektive eines jungen Mädchens, vermutlich aus der Zeit Anfang der 1910er Jahre; darunter der relevante Bildausschnitt, der einen Hinweis auf den Beginn der Speiseeisherstellung liefert

Die Bildunterschrift lautet: „Das ist die Bahnstraße mit unserer Schule und dem Cafehaus. Dort kriegt man auch Gefrorenes (Anm.: Speiseeis), nämlich im Cafehaus.“
Im Vordergrund die prachtvolle Zinshäuser Bahnstraße 1 (Josef Dunkl jun. bzw. später Fam. Freund) und 1a (Stadtsekretärs Alexander Zickl), die im 2. Weltkrieg zerstört wurden. Dahinter die Mädchenschule und ganz klein im Hintergrund – aufgrund des markanten Türmchens dennoch erkennbar – das Kaffeehaus.
Bildnachweise:
-) Kaffeehaus Schindler (Ausschnitt aus Mehrbildkarte), Außenansicht Café Rössler & Postkarte „Gruss aus Mistelbach“ aus der Sammlung von Herrn Gerhard Lichtl – digitalisiert und zur Verfügung gestellt von Herrn Otmar Biringer
-) Innenansichten Café Rössler – ausgestellt im Café Harlekin
-) Innenansichten Café Heindl – Mistelbacher-Laaer Zeitung, Nr. 29/1958, S. 4
-) Café Heindl – Göstl-Archiv
-) Bekleidungsgeschäft Tila & Innenansicht Harlekin – zur Verfügung gestellt von Reinhard Kruspel
Quellen: